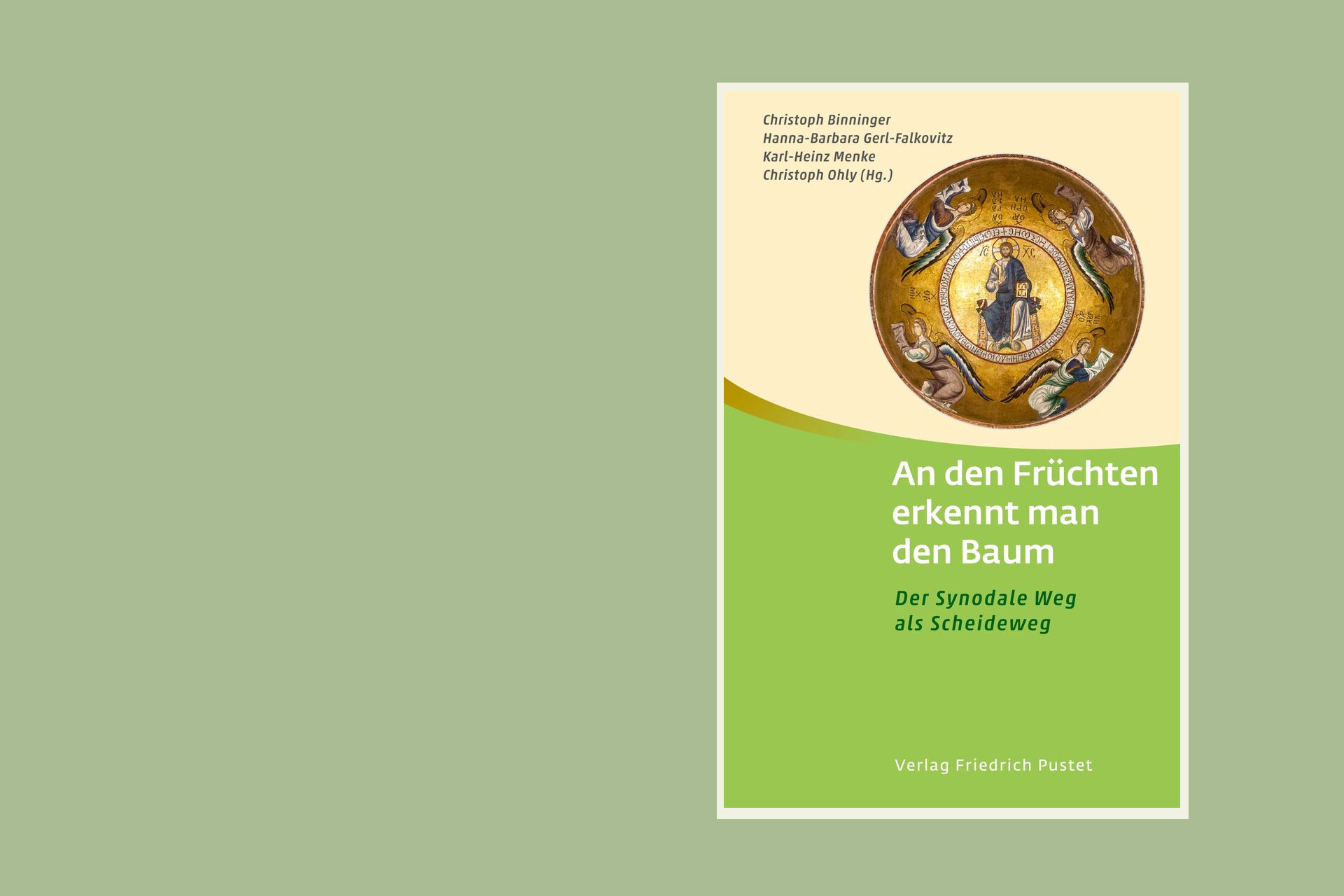Suche
Kategorien
Seiten
Nachrichten
Bilder
Videos
{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Seite{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Neuigkeit
Kirchen aus dem Bistum: St. Peter und Erasmus, Geiselhöring
Lichtspiel zeigt den Weg des Glaubens
Geiselhöring / Regensburg, 21. Februar 2025.
Eine großartige Baugeschichte, dazu die sehr imposante Architektur – das zeichnet die Peterskirche in Geiselhöring aus. Doch außerdem kann diese Kirche zweimal im Jahr, wenn die Sonnenbahn exakt passend verläuft, mit einem einzigartigen Lichtspiel aufwarten. Durch bestimmte Fenster werden dann Lichtstrahlen gebündelt, die nach und nach die zentralen Figuren der biblischen Verkündigung rund um den Hochaltar wie mit Scheinwerfern anstrahlen. Eine faszinierende Besonderheit!
Der Grund, auf dem die Kirche St. Peter und Erasmus in Geiselhöring steht, ist der Ursprungsort des ganzen, heute über 7.000 Enwohner zählenden Ortes. Wo die Kirche St. Peter und Erasmus steht, befand sich im fünften oder sechsten Jahrhundert der Herrensitz des Ortsgründers Giselher – ein sicherlich aus Holz gebautes, vielleicht mehrere Gebäude umfassendes, jedenfalls aber turmloses Ensemble. Ein langer Weg war es von dort bis zur ersten örtliche Pfarrei. Die wurde erstmals im Jahr 1249 in einem Schutzbrief von Papst Innozenz IV. urkundlich erwähnt. Damals war St. Jakob Pfarrkirche des Ortes. Diese, auch Linskirche genannt, ist die älteste Kirche Geiselhörings. Im Laufe der Zeit verlor diese Kirche an Bedeutung, so dass St. Peter, inzwischen auf dem Gelände des ältesten Ortskerns erbeut, zur Pfarrkirche Geiselhörings erhoben wurde. Das ist sie bis heute.
In ihrer heutigen Form wurde die Kirche St. Peter in der Zeit von 1761 bis 1764 im Stil des Rokoko errichtet. Die kunstvolle Gestaltung und die reiche Verzierung machen sie zu einem bedeutenden Bauwerk in der Region. Der Chor und das Turmuntergeschoss stammen noch von einem mittelalterlichen Vorgängerbau. Der Chor wurde noch in den Jahren 1610 und 1611 im spätgotischen Stil umgestaltet. Für den späteren Rokokobau wurden allerdings die Fenster verändert. Zudem wurden im Inneren die Gewölberippen abgeschlagen. Außen wurden die Strebepfeiler an der südlichen Langhauswand mit einer geschwungenen Deckplatte versehen.
Eine Renovierung fand im Jahr 1895 statt. Bei dieser Maßnahme entstand ein neues Deckenfresko im Chor. Es wird davon ausgegangen, dass das Vorgängerwerk als unbefriedigend angesehen wurde oder noch 1746 entstanden war und sich nicht in die Raumgestaltung einfügte. Im Zuge einer weiteren Renovierung in den Jahren 1979 bis 1983 wurde dann aber die ursprüngliche Farbgebung wiederhergestellt. Das Äußere der Kirche zeigt seitdem wieder einen weißen Anstrich mit hellroten Lisenen.
Petrusdarstellung unter der Decke
Besonders eindrucksvoll sind die Fresken, die der Maler Matthäus Günther erstellt hat. Sofort fällt das monumentale Deckenfresko im Langhaus ins Auge. Es stellt passend zum Patrozinium der Kirche die Kreuzigung Petri dar. Die Szene spielt sich zwischen Ruinen römischer Bauwerke ab, die auf den Niedergang des Heidentums verweisen sollen. Ein Rundtempel auf einem Felsen steht als Symbol für die Kirche Gottes, die im antiken Rom heranwächst. An zentraler Stelle im Mittelpunkt des Fresko befindet sich das Gottesauge, umgeben von einem Strahlenkranz. Als Gottesauge bezeichnet man ein Dreieck mit einem Auge darin. Dieses Symbol steht für die Dreifaltigkeit. Das Auge ist von Engeln umgeben. Umgeben ist das Fresko von einem Stuckrahmen mit Rocaille-Ornament. Acht Zwickelbilder finden sich in den Flächen zwischen den Stichkappen. Sie sind in Grisaille-Technik gemalt. Das sind Bilder in grau, weiß und schwarz. Umgeben sind die Bilder von stuckmodellierten Blumengirlanden. Sie stellen Szenen aus dem Leben des Heiligen Petrus dar: Petrus heilt Kranke, Petrus treibt böse Geister aus, Petrus erweckt Tote zum Leben und die Vision des Petrus finden sich auf der rechten Seite. Auf der linken Seite sind zu sehen: Petrus vor dem Hauptmann Cornelius, Petrus im Gefängnis, die Befreiung aus dem Gefängnis und die Begegnung Petri mit dem kreuztragenden Jesus. Die Legende spricht davon, dass Petrus vor der Verfolgung aus Rom fliehen wollte. An der Via Appia begegnete er Christus und fragte ihn die berühmten Worte „Domine, quo vadis?“ – „Wohin gehst Du, Herr?“ Jesus soll geantwortet haben, er gehe nach Rom, um sich erneut kreuzigen zu lassen. Beschämt kehrte Petrus um und nahm das Kreuz auf sich. An der Via Appia Antiqua erinnert die Kirche St. Maria in Palmis an das Ereignis.
Das Geiselhöringer Deckengemälde im Chor wurde im Jahr 1895 im Nazarenerstil erstellt und zeigt die Pfingstpredigt des heiligen Petrus. Die vier Zwickelbilder im Chor weisen symbolische Darstellungen auf: eine Kirche auf Felsengrund, die Insignien des Papsttums, das Lamm auf dem Buch mit den sieben Siegeln und die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe.
Der Hochaltar der Kirche hat einen viersäuligen Aufbau aus rotgrauem Stuckmarmor. Das aus Stuck nachgebildeter Marmor. Außen stehen Plastiken des heiligen Erasmus und des heiligen Stephanus. Das große Altarblatt stellt die Schlüsselübergabe an Petrus dar. Im Auszug ist unterhalb der Baldachindraperie das von einem Wolkenmeer umgebene Auge Gottes zu sehen. Auf der Altarmensa erhebt sich ein geschweifter Tabernakel, der mit Rokoko-Muschelwerk und Engelsfiguren verziert ist. Unter dem Chorbogen steht der Volksaltar von 1982. Er ist eine Kopie der Hochaltarmensa. Ebenso wie der Ambo gleicht er sich harmonisch an den Stil der übrigen Ausstattung an. Die fünf Seitenaltäre sind ebenfalls mit Muschelwerk verzierte, konkave Altäre mit zweisäuligen Aufbauten aus Stuckmarmor.
Rechts des Chorbogens ist der Marienaltar, der eine Kopie des Gnadenbildes Mariahilf von Lucas Cranach d. Ä zeigt. Auf der Mensa steht ein von Anbetungsengeln flankierte Tabernakel, der von einer Holzfigur des Prager Jesuskindes bekrönt wird. Auf der linken Seite des Chorbogens steht der Kreuzaltar. Auf dem Altarblatt ist die Kreuzabnahme Jesu zu sehen. Darunter befindet sich eine barocke Holzfigur des Auferstandenen. Beide Chorbogenaltäre schließen nach oben mit einem Obelisken ab, der von einer ornamentalen Krone umgeben ist. Auch die Kanzel ist mit Stuckmarmor und Muschelwerk verziert. Am Korpus finden sich vier Engel mit Gesetzestafeln, Kreuz, Gerichtsposaune und Gerichtswaage sowie mit dem Buch mit den sieben Siegeln. Auf dem Schalldeckel erinnern Engel mit päpstlichen Insignien und Kirchensymbolen an den Kirchenpatron Petrus. Über dem Chorbogen findet sich eine Uhr aus Stuck.
Das Theatrum sacrum
Ein besonderes Schauspiel in der Kirche zeigt sich in jedem Jahr am Frühlings- und Herbstanfang. Eine bauliche Besonderheit der Kirche ist Ausrichtung. Sie ist nicht exakt nach Osten ausgerichtet, sondern um etwa zehn Grad nach Norden gedreht. Die runden Fenster am Westportal wirken daher zweimal im Jahr wie große Scheinwerfe. Damit beginnt dann an diesen beiden Tagen, wenn der Himmel sich wolkenlos zeigt, gegen 17 Uhr ein großes Schauspiel: Die Vorhangengel rechts und links des Tabernakels scheinen den Vorhang aufzuziehen. Vier Minuten später erstrahlt der Tabernakel in hellem Licht. Im nächsten Akt werden der Heilige Erasmus und der Heilige Stephanus angestrahlt. Das Licht wandert nach oben und zeigt das Auge Gottes und einen Engel hell erleuchtet. Die Wolken oben am Hochaltar reflektieren das Licht an die Decke. Das Fresko mit der Pfingstpredigt des Heiligen Petrus beginnt rötlich zu glühen. Um 18 Uhr beendet ein kleiner Putto, der mit einem Blumenzweig hoch oben vom Hochalter winkt, die heilige Schau. Bis in einem halben Jahr das Theatrum sacrum erneut beginnt.
Text: Peter Winnemöller
(sig)
Weitere Infos
In der Reihe Kirchen aus dem Bistum Regensburg stellen wir Kirchen, Klöster und Kapellen vor, die sich im weiten Einzugsgebiet der Diözese befinden.