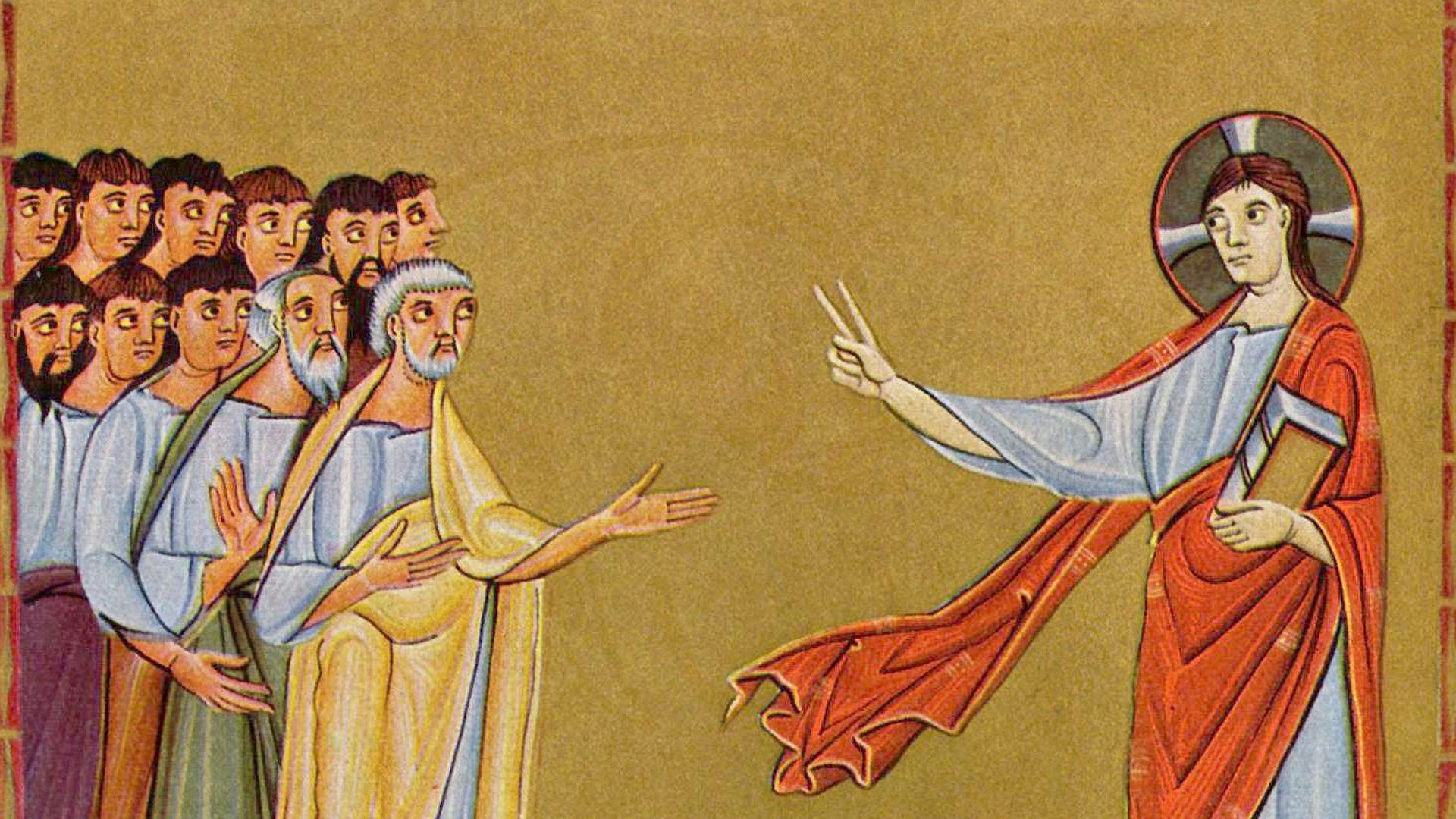Suche
Kategorien
Seiten
Nachrichten
Bilder
Videos
{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Seite{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Neuigkeit
Kirchen aus dem Bistum: Maria Schnee Aufhausen
Schnee im August
Regensburg, 3. April 2025
Ein nicht ganz alltägliches Patrozinium hat die Wallfahrtskirche in Aufhausen. Es geht auf eine antike Legende zurück. Das Gnadenbild ist eine Kopie von Maria Schnee in Rom und erfreut sich großer Verehrung.
Die heutige Wallfahrtskirche Maria Schnee in Aufhausen ist eine Rokokokirche, die in den Jahren 1736 bis 1740 gebaut wurde. Wegen einer zunächst mangelnden Ausstattung konnte die Kirche erst 1751 geweiht werden. Der Turmbau zog sich sogar bis 1761 hin. Die Geschichte der Wallfahrt und damit dieser Kirche hat jedoch rund ein Jahrhundert vorher begonnen. Sie hängt zusammen mit einem Gnadenbild, das zunächst von Herzog Wilhelm V. dem Jesuitenkolleg in München geschenkt worden war. Hier wurde es auf dem Dachboden abgestellt. Der Student und spätere Pfarrvikar in Aufhausen, Johann Georg Seidenbusch, bekam diese Muttergottesstatue für gute Leistungen geschenkt und nahm sie von München zunächst mit nach Ingolstadt. Ab 1667 war der Priester in Aufhausen tätig und stellte die Mutter Gottes zunächst im Pfarrhaus auf, wo täglich vor ihr gebetet wurde. Im Jahr 1668 errichtete der Pfarrvikar eine Holzkapelle und die Wallfahrt nach Aufhausen begann. Diese Kirche war der erste Vorläufer der heutigen Kirche. Die Wallfahrt erlebte schnell eine Blüte, denn zwischen 1670 und 1689 wurde von 132 Gebetserhörungen berichtet. In den Jahren 1670 bis 1673 wurde die Kapelle durch eine erste kleine barocke Wallfahrtskirche ersetzt. Diese wurde in der Region als Marianisches Haus bezeichnet. Seidenbusch war als einzelner Priester mit der Wallfahrtsseelsorge bald überfordert. Er gründete zur Betreuung der Pilger das Kloster Aufhausen. Dies war das Oratorium des heiligen Philipp Neri in Deutschland. Im Jahr 1692 wurde ein Vertrag mit dem Kloster Sankt Emmeram in Regensburg dazu geschlossen. Die offizielle Einrichtung des Oratoriums erfolgte mit päpstlicher Anerkennung am 6. Juli 1695.
Die Wallfahrtskirche Maria Schnee
Der heutige rechteckige Kirchenbau aus dem Rokoko hat eine Länge von 35 Metern und ist 22 Meter breit. Die Kirche ist nicht geostet, sondern nach Norden ausgerichtet. Äußerlich ist sie sehr schlicht gehalten. Die Südfassade weist zur Hauptstraße des Ortes hin und ist aufgrund eines steil abfallenden Hanges weithin sichtbar. Die Fassade ist leicht kurviert, das ist eine Form der Gestaltung, bei der die Oberfläche nicht eben, sondern gewellt oder kurvig ist. Die Fenster liegen etwas zurück in den Rundungen der Fassade. Diese wird durch Pilaster und Gesimse in drei Achsen gegliedert. Nach oben hin schließt sie mit einem Dreiecksgiebel ab, der eine Figurennische aufweist, in der eine Statue der Maria Immaculata steht. Der Turm befindet sich an der Nordseite der Kirche. Über dem quadratischen Untergeschosses erhebt sich das Glockengeschoss mit abgerundeten Ecken und Schallöffnungen zwischen jeweils zwei Pilastern. Der Turm schließt nach oben mit Zwiebelhaube und Laterne ab.
Eine bauliche Besonderheit der Kirche ist der achteckige Hauptraum, der den rechteckigen Grundriss der Kirche verbirgt. Dem Innenraum ordnet sich eine südliche Vorhalle mit breitem Mitteljoch und schmalen Seitenjochen zu. Der Chor liegt im Norden und schließt den Bau mit den beidseitigen Sakristeianbauten ab. An den beiden Enden der Querachse des Hauptraumes finden sich Kapellennischen. Weitere Nischen finden sich an den vier Enden der Diagonalachsen. Über diesen finden sich jeweils Oratorien mit geschweiften Brüstungen. Der Hauptraum wird wie die Nischen und Oratorien von einer Flachkuppel überspannt. Für eine Rokokokirche hat Maria Schnee wenig Stuck. Dafür ist der Kirchenraum sehr reichhaltig ausgestattet. Die Deckenfresken stellen vor allem die Gottesmutter Maria dar. Das große Deckengemälde des Hauptraumes zeigt die Maria-Schnee-Legende, die der Münchner Maler Franz Joseph Zitter mit Bezug auf Aufhausen interpretiert hat. Dies ist die Legende, die dem Gnadenbild zugrunde liegt, dessen Kopie in Aufhausen verehrt wird. Der römischer Patrizier Johannes und seine Frau erhielten von Maria in einer Vision das Versprechen, dass der Wunsch des Paares nach einem Sohn in Erfüllung gehe, wenn ihr zu Ehren eine Kirche an der Stelle errichtet werde, wo am nächsten Morgen Schnee liege. Obwohl es der 5. August war, fand Johannes den römischen Hügel Esquilin schneebedeckt vor. An diesem Ort steht heute die Basilika Santa Maria Maggiore. Der 5. August ist auch das Fest des Weihetages der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom. Der Volksmund nennt das Fest in Italien Madonne della Neve (Maria im Schnee). Das Chorfresko in Aufhausen zeigt den heiligen Philipp Neri, der vor der Gottesmutter kniet. In den umgebenden Zwickelbildern finden sich Szenen aus dem Leben des Heiligen.


Altäre mit bedeutenden Kunstwerken
Der Hochaltar stammt noch aus dem barocken Vorgängerbau. Es handelt sich um einen barocken Ädikula-Altar mit zweisäuligem Aufbau. Ädikula bezeichnet ein kleines Bauwerk. Im Sakralbau kennt man den Begriff bei kleinen Tempeln, großen Grabmälern, Heiligenhäuschen oder eben wie ein Haus geformte Altäre. Neben den Säulen stehen links Johannes der Täufer und rechts der Evangelist Johannes. Den oberen Abschluss bildet ein holzgeschnitztes Kruzifix. Zwischen den Säulen findet sich das Gnadenbild Maria Schnee in einem ovalen Glasschrein. Im Unterbau des Hochaltares, auch Stipes genannt, sind die Gebeine des heiligen Desiderius beigesetzt. Der Altar selbst ist für den Bau zu klein und zu niedrig. Daher wurde der Aufbau durch Illusionsmalerei an der Apsis-Rückwand optisch vergrößert. Es wird die Illusion eines zusätzliches Säulenpaares und einer gebogenen Form erzeugt. Das Wandgemälde oberhalb des Altares setzt die Bildsprache fort. Hier wird Gott Vater dargestellt, der gemeinsam mit der Heilig-Geist-Taube am Auszug und dem Kruzifix auf dem Altar die Dreifaltigkeit versinnbildlicht. Die beiden großen Seitenaltäre befinden sich in den breiten flachen Nischen auf der Ost- und Westseite des Hauptraumes. Der östliche Seitenaltar ist dem Heiligen Josef geweiht. Das Altarblatt zeigt den heiligen Josef mit Maria und dem Jesuskind. Im Auszug ist Maria Magdalena als Büßerin dargestellt. Der westliche Seitenaltar ist ein Herz-Jesu-Altar. Er enthält über dem Tabernakel ein kleines Herz-Jesu-Bild. Das Altarblatt zeigt die Pfingstvision des heiligen Philipp Neri. Im Auszug ist der Apostel Petrus zu sehen. Vier silbern gefasste Holzbüsten stehen auf den Seitenaltären. Sie zeigen die Heiligen Karl Borromäus und Ignatius von Loyola am Josefsaltar sowie die Heiligen Philipp Neri und Franz von Sales am Herz-Jesu-Altar.
In der nordwestlichen Diagonalkapelle, der Frauenkapelle, befindet sich das wohl bedeutendste Werk der Kircheneinrichtung von Maria Schnee. Das Altargemälde trägt den Titel „Madonna in der Halle“. Das Werk entstand um 1515 und wird dem Augsburger Maler Jörg Breu d. Ä. zugeschrieben. Das Bild wurde der Kirche 1696 gestiftet. Es ist von einem prachtvollen Akanthusrahmen mit Putten umgeben. Ähnlich ist auch der Altar in der nordöstlichen Philipp-Neri-Kapelle gestaltet, der ebenfalls 1696 gestiftet wurde. Das Altargemälde zeigt den Heiligen im Messgewand als Patron der Sterbenden und der Armen Seelen. In den südlichen Diagonalkapellen, der Karl-Borromäus-Kapelle im Südwesten und der Franz-Sales-Kapelle im Südosten, befinden sich ebenfalls Renaissance-Altäre mit Ädikula. Am Karl-Borromäus-Altar befindet sich eine Wachsarbeit von der Kreuzesvision des heiligen Bernhard von Clairvaux. In der Ädikula befindet sich eine Schutzengeldarstellung. Die Ädikula des Franz-Sales-Altares zeigt eine Darstellung des Erzengels Michael mit der Seelenwaage.
Die Wallfahrt erlebt in Aufhausen in unseren Tagen eine neue Blüte, nicht zuletzt dadurch, dass sie an eine Tradition des Gründers der Wallfahrt anknüpft. Im Jahr 2012 gab der Bischof von Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, seine Zustimmung und Papst Benedikt XVI. wandelte am 15.9.2012 die Brüdergemeinschaft vom Heiligen Blut, die sich 2006 gegründet hatte, in die „Kongregation des Oratorium des hl. Philipp Neri in Aufhausen“ um. Aus diesem Grund nennt sich die Gemeinschaft von Aufhausen auch „Oratorianer vom Heiligen Blut“.
Text: Peter Winnemöller
(kw)
Weitere Infos
In der Reihe Kirchen aus dem Bistum Regensburg stellen wir Kirchen, Klöster und Kapellen vor, die sich im weiten Einzugsgebiet der Diözese befinden.