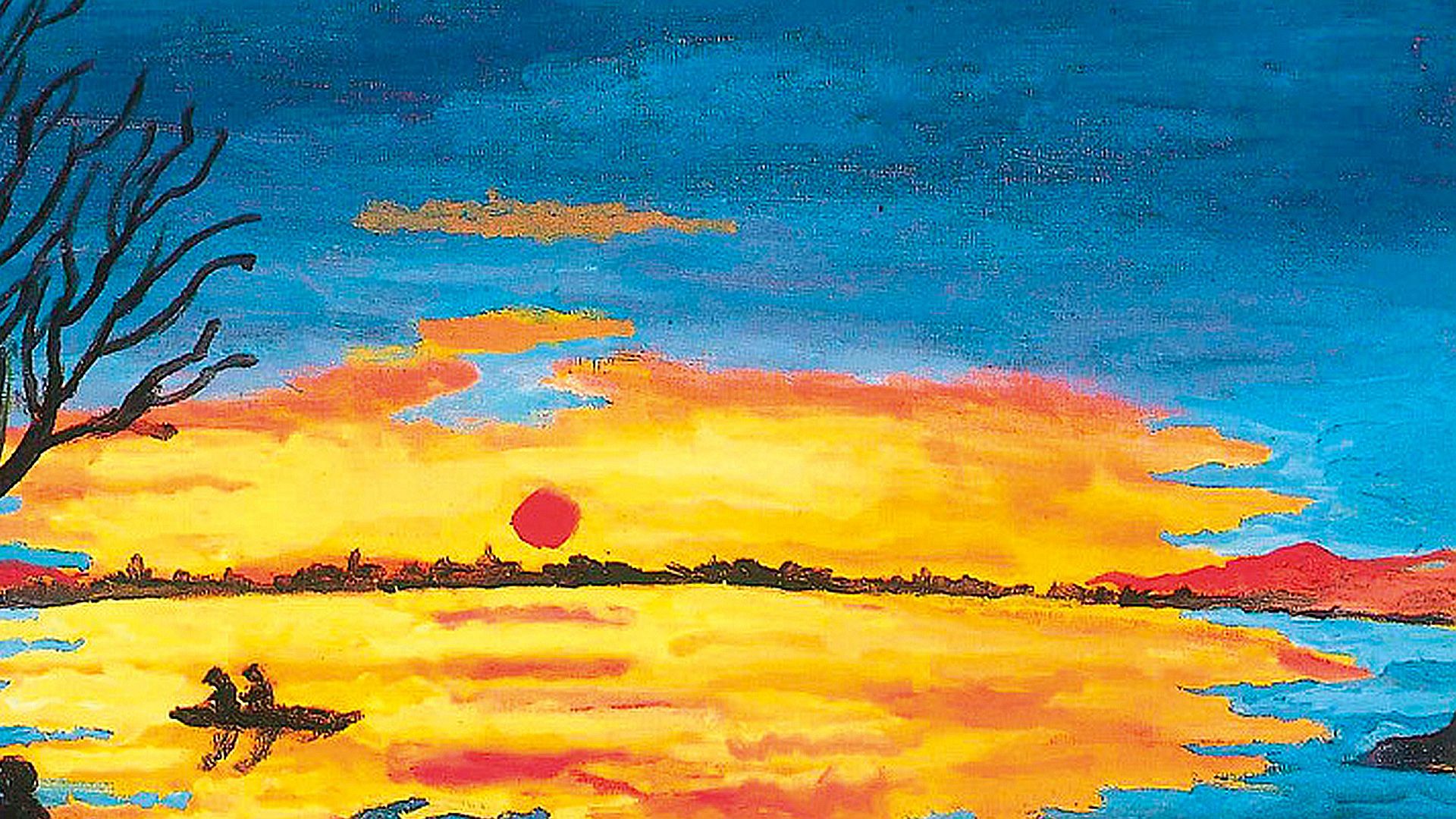Suche
Kategorien
Seiten
Nachrichten
Bilder
Videos
{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Seite{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Neuigkeit
Das neue „Institut für religiöse Alltagskultur“
Blick hinter die Kulissen
Regensburg, 21. März 2025
Kaum zu übersehen ist derzeit die große Baustelle inmitten der Regensburger Altstadt. In dem ehemaligen Ehrenfelser Hof, in der Schwarzen-Bären-Straße 2, entsteht derzeit das „Institut für religiöse Alltagskultur“. Die Baumaßnahmen gehen bis Mitte nächsten Jahres, danach geht es an die Einrichtung und den Umzug der Objekte, erklärt Christa Haubelt-Schlosser, die Fachstellenleiterin Religiöse Volkskunst.

Das Institut gehöre zu den Kunstsammlungen des Bistums Regensburg, so Anna Amann, Volontärin. Es beschäftige sich „eben intensiv mit dieser einen Sammlungssparte, die ansonsten auch immer ein kleines bisschen untergeht“.
Das Institut erfüllt eine Doppelrolle: es ist zugleich Schaudepot und Forschungsort zu den verschiedenen Bereichen der religiösen Volkskunst, erklärt Christa Haubelt-Schlosser, Leiterin der Fachstelle. An Projekten sei für das Institut noch vieles geplant. Man wolle nicht nur gemeinsam mit der Universität forschen, sondern auch Kurse und Seminare anbieten und kleinere Ausstellungen konzipieren, ergänzt Amann.
Im Erdgeschoss des Gebäudes schließt rechts an den Einfang ein Raum ein, der zur „Werkstatt“ umgebaut wird. Dieser soll einem vielfältigen Angebot an Workshops Platz bieten. Zur rechten des Eingangs schließt sich die stockwerkübergreifende Galluskapelle an. Dem Eingang voraus öffnet sich ein Raum um die Treppe herum. Die Treppe selbst werde mit Hinterglasbildern verziert, so Haubelt-Schlosser. Eine Art Litfaßsäule solle oberhalb angebracht werden, die die Menschen zum Thema religiöse Volkskunst sprechen lasse. Den Besuchern solle klar sein: „Wir machen dieses Institut, dieses Haus für die Menschen, die eben auch hinter dieser religiösen Volkskunst stehen.“
Auch im oberen Geschoss öffnet sich ein Raum um die Treppe herum. Dieser bilde das „Herzstück unseres Instituts“, so die Leiterin der Fachstelle. Als Herzstück bezeichne sie diesen Teil, weil sie hier die Möglichkeit habe, die religiöse Volkskunst, so wie sie in den Kunstsammlungen vorhanden sei, präsentieren zu können. „Alles was dazugehört, bis hin zu den kleinsten Objekten um diesen, ich nenn es gern, Kosmos religiöse Volkskunst tatsächlich im gesamten darstellen zu können“. Im oberen Geschoss gebe es außerdem Büro- und Forschungsräumlichkeiten sowie einen Dialograum, in dem Forschungsergebnisse präsentiert und diskutiert werden können, so Haubelt-Schlosser.


Galluskapelle
Die Galluskapelle sei ein ganz spannender Ort, finden sowohl Amann als auch Haubelt-Schlosser. Derzeit wird noch renoviert. Das Mauerwerk ist an einigen Stellen freigelegt. Der Boden ist, bis auf ein Loch inmitten des Raumes, mit Platten verdeckt. Silberne Rohre, Steine, Holzplatten, ein Tisch, auf dem eine Schachtel abgestellt ist und ein Gerüst sind über den Rest des Ortes verteilt. Die Galluskapelle reiche bis ins 12. / 13. Jahrhundert zurück und sei in den wichtigsten Bauelementen romanisch, erklärt Haubelt Schlosser. Auch die der Galluskapelle zugehörige Galluspforte stamme aus dem hohen Mittelalter. Der Rest des Gebäudes sei zumeist aus dem Barock, so Haubelt-Schlosser. Die aktuellen Baumaßnahmen arbeiten daran, den jahrelangen nicht sichtbaren Raumeindruck wiederherzustellen, so Haubelt-Schlosser. Weil die Zwischendecke in der Kapelle aus dem 19. Jahrhundert stamme, „hat man sich dazu entschlossen, sie zu entnehmen und diesen Raumeindruck wieder zu erhalten“, erklärt die Fachstellenleiterin. Das Entnehmen der Decke würde ein „wahnsinns Raumgefühl“ erzeugen, findet auch Amann. Das einzige Exponat, das sich die Fachstellenleiterin Christa Haubelt-Schlosser für den Raum wünsche, sei die Kulisse eines heiligen Grabes aus dem österlichen Brauchtum, die aufgrund des sakralen Bezuges gut in den Raum hineinpassen würde.
Eine Werkstatt für Workshops
Im Erdgeschoss gebe es zusätzlich den Vermittlungsraum beziehungsweise die Werkstatt, erklären Amann und Christa Haubelt-Schlosser. Derzeit ist es noch ein leerer Raum mit einem behelfsmäßigen Tisch, gefüllten blauen Müllsäcken, Holzplatten und heraushängenden Kabeln. Nach den Renovierungsarbeiten solle der Raum mit Stühlen, Tischen und Werkbänken ausgestattet werden und Teilnehmern der Workshops Platz bieten, so Amann. Die Workshops drehen sich um verschiedene Thematiken mit Bezug aufs Institut, wie die Ikonenmalerei, Krippenbaukurse, Hinterglasmalerei oder Klosterarbeit, erklären Haubelt-Schlosser und Amann. Verschiedene Angebote bestünden das ganze Jahr über und richteten sich an verschiedene Zielgruppen, für Jung und Alt, so Amann. Das Programm werde je nach Interesse der Menschen angepasst.


Zusammenspiel aus Forschung und Schaudepot
Im wissenschaftlichen Teil des Instituts würden sämtliche Bereiche der religiösen Volkskunst erforscht, so Haubelt-Schlosser. Aber nicht nur die alleinigen Objekte seien von Interesse, ergänzt Amann, man wolle auch immaterielle Sachen erforschen wie zum Beispiel Bräuche. Dabei ginge es nicht speziell um Objekte, sondern die Geschichte, die daran aufgezeigt würde. Sie möchten auch Interviews mit Menschen und deren Beziehung zu den Objekten führen, erklärt die Volontärin, denn „es sollen nicht nur die Objekte sein, sondern auch der Mensch dahinter.“
Neben der Forschungsarbeit sei das Institut zugleich ein Schaudepot, in dem sie eine Vielzahl an Objekten wie Krippen, dem Wallfahrtsbereich mit Votivbildern, Hinterglasbilder, Heiligenfiguren, Adventskalender und vieles mehr zeigen würden, ergänzt Haubelt-Schlosser. Dabei seien nicht allein typische Objekte religiöser Volkskunst von Interesse, sondern auch Objekte mit persönlicher Note, wie Versehkreuze, so Amann. Ein Schaudepot sei kein Museum mit Besuchszeiten, erklärt die Leiterin der Fachstelle. Anders als im Museum würden Besucher aber Zusammenstellungen sehen, die es so nicht in Museen gebe, wie zum Beispiel 100 Rosenkränze an einem Platz.
Auch Amann findet die Idee des Schaudepots interessant. „Wir haben ja keine Ausstellung, sondern es ist eine Sammlung, die gezeigt wird“, erklärt sie. Das könne auch für Laien interessant sein, um erklären zu können, wie ein Museum arbeite und „da vielleicht zu erklären, was passiert denn alles hinter den Kulissen“, führt sie aus.
Auf welche Anzahl sich die ausgestellten Objekte belaufen, könne man derzeit nicht sagen, „aber ich gehe mal von einem Drittel bis zur Hälfte der jetzigen gerade bestehenden Sammlung aus.“ Dabei beläuft es sich auf 1500 bis 2000 Objekte.

Text und Fotos: Lea Grosser
Video: Harald Beitler
(lg)