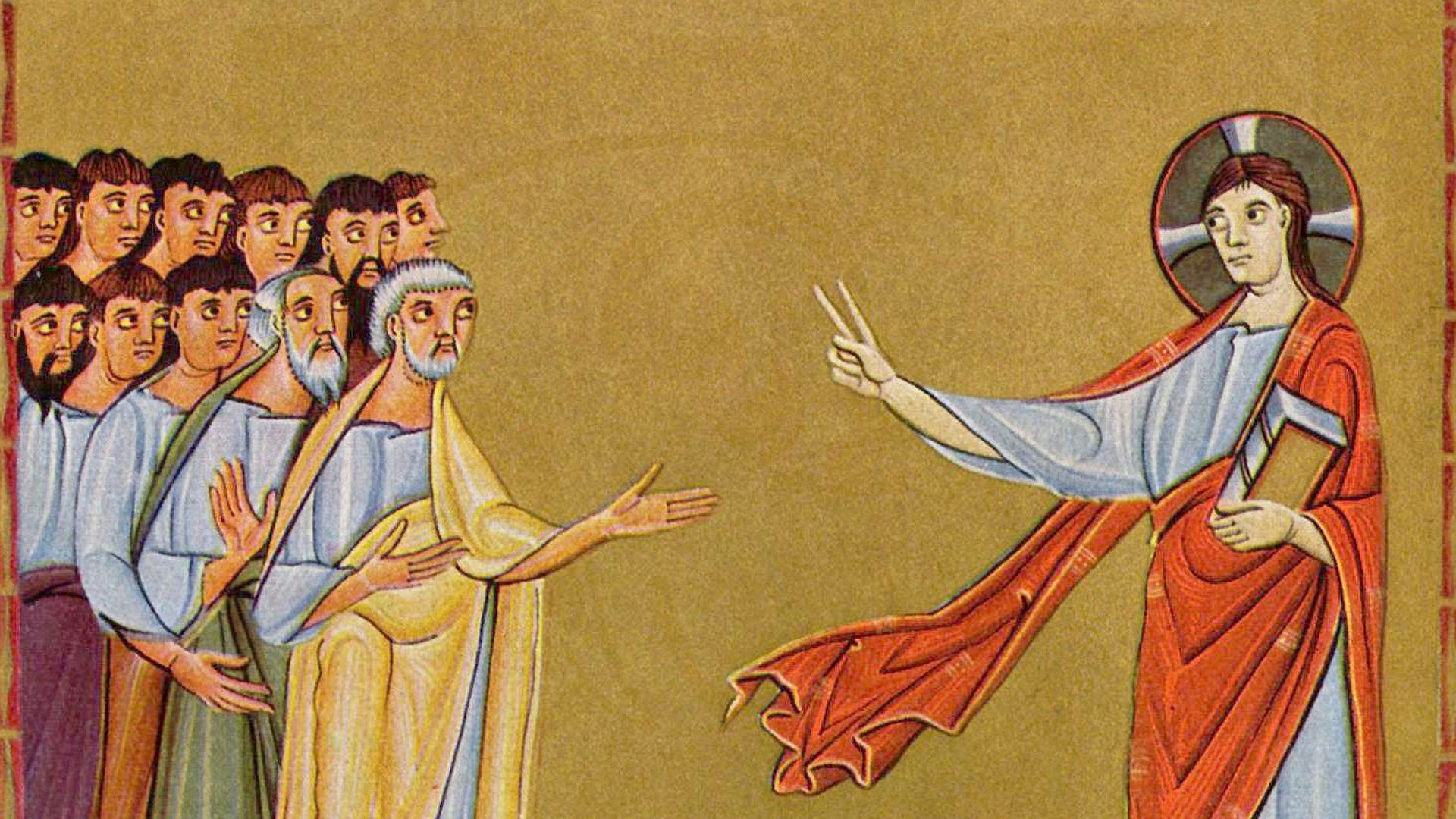Suche
Kategorien
Seiten
Nachrichten
Bilder
Videos
{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Seite{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Neuigkeit
Person der Woche: Generalvikar Dr. Roland Batz
„Wir nehmen die Sorgen und Ängste der Gläubigen sehr ernst“
Regensburg, 20. Juni 2025
Im Interview mit der Pressestelle erläuterte Generalvikar Dr. Batz die Herausforderungen der „Pastoralen Entwicklung 2034“, gab Einblicke in die Arbeit der Verwaltungsleiter und der Katechisten in der Diözese. Darüber hinaus sprach Batz über die Themen demografische Entwicklung, Synodalität sowie Missbrauch und welche Rolle die Kirche in der Zukunft spielt.
I. Strukturwandel in der Diözese
Herr Dr. Batz, welche Grundüberlegungen leiten die „Pastorale Entwicklung 2034“ – mehr als eine organisatorische Reform?
Angesichts veränderter gesellschaftlicher und pastoraler Rahmenbedingungen ist es wichtig, Bedingungen zu schaffen, damit die kirchlichen Grundfunktionen: das Bekenntnis zu Jesus Christus, die Feier der Liturgie und der Sakramente sowie die gelebte Nächstenliebe auch künftig in den Pfarreien/PG erlebbar und wirksam werden können. Kurzum: Es geht um die Anschlussfähigkeit des Glaubens an das Leben der Menschen von heute. Kirche möchte ein „Lebens-Mittel“ sein, das durch Gebet, Gottesdienst und Caritas die Menschen stärkt, tröstet und aufrichtet. Um auch künftig in dieser Weise für die Menschen da sein zu können, braucht es eine strukturelle und organisatorische Anpassung der vorhandenen Ressourcen.
Wie bewahren Sie die geistliche Identität einzelner Pfarreien, wenn Sie in größeren Gemeinschaften aufgehen sollen?
Durch die „Pastorale Entwicklung“ (PE34) lösen sich keine kleinen in größere Einheiten auf. Was sich verändert, und das gilt es ernst- und wahrzunehmen, ist das Lebensgefühl und die Lebensgestaltung der Menschen von heute. Jüngere Gläubige haben heute ein anderes Verhältnis zur Kirche als das bei älteren Generationen der Fall ist; wir sehen, dass Menschen Institutionen kritischer gegenüberstehen – Stichwort: Autonomie. Dazu kommen eine weitaus größere Mobilität und die Digitalisierung, die tief in das Leben der Menschen heutzutage eingreifen. Die entscheidende Identität für Christen aber ist und bleibt der Glaube an den gekreuzigt-auferstandenen Herrn. Angesichts dessen sehe ich es als großen Reichtum an, wenn sich kirchliches Leben in neuer Weise entwickelt und damit andere Ausdrucksformen entstehen. Zudem bleiben die Pfarreien ja als eigenständige Größen und als Bezugspunkte kirchlichen Lebens erhalten. Damit orientieren wir uns an dem sozialethischen Prinzip der Subsidiarität.
Welche Rolle spielt kirchliches Recht bei der Bildung von Pfarreiengemeinschaften, und wie flexibel darf es dabei gehandhabt werden?
Das kirchliche Recht ist zu wahren und bedarf der Umsetzung. Daher achten wir im Rahmen der PE34 darauf, dass das Recht seine Anwendung findet: etwa bei der Leitung der PG oder bei der Zusammenarbeit der einzelnen Pfarreien in der PG.
Ist das Ziel von 139 Pfarreiengemeinschaften bis 2034 realistisch – und was passiert, wenn personelle Ressourcen fehlen?
Bei einem Prozess, der auf 9 bis 10 Jahre angesetzt ist, kann man schwerlich davon ausgehen, dass alles so aufgehen wird, wie wir es uns im Idealfall vorstellen und wünschen. Es braucht aber eine Grundlage, an der wir uns orientieren können. Und so gehen wir von der Grundlage aus, dass wir unsere 631 Pfarreien bis 2034 in 139 PG zusammenführen möchten. Dies ist insofern ein realistisches Ziel, weil wir uns an den personellen Ressourcen einerseits, der Zahl der Gläubigen andererseits und an den geographischen Gegebenheiten orientiert haben. Bei aller Komplexität und noch mancher Unübersichtlichkeit dürfen wir aber die Gelassenheit und den Mut nicht verlieren und wollen positiv und entschlossen an diesem Ziel weiterarbeiten, weil es darum geht, den Glauben an Jesus Christus auch für die kommenden Generationen als Heilsangebot und Lebenshilfe anzubieten.
Wie nehmen Sie die Sorge der Gläubigen ernst, viele haben ja Angst, dass ihnen ihre geistliche Heimat genommen wird?
Wenn sich Veränderungen auftun, dann geht das immer mit Sorgen und Verlustängsten einher. Diese Sorgen und Anfragen nehmen wir sehr ernst. Daher sind wir mit den Verantwortlichen in den Dekanaten und den Gläubigen in den Pfarreien im regelmäßigen Austausch. Am besten natürlich durch die unmittelbare Begegnung, was aber noch nicht überall geschehen konnte. Wir versuchen auch durch einen Rundbrief und durch Informationen auf der Homepage mit allen Interessierten in Kontakt zu treten und zu bleiben.
II. Rolle von Verwaltung und Leitung
Wie verändert sich das Selbstverständnis eines Pfarrers, wenn ihm ein Verwaltungsleiter zur Seite gestellt wird?
Das Selbstverständnis des Pfarrers wird weder durch die PE34 noch durch die VL verändert. Der Pfarrer ist und bleibt der Leiter der Pfarrei bzw. der jeweiligen PG. So wie ihm die pastoralen Mitarbeiter in professioneller Weise in der Pastoral unterstützen und zuarbeiten, steht ihm künftig ein Verwaltungsleiter in den administrativen Angelegenheiten, d. h., in wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Fragen professionell zur Seite.
Was verändert sich durch die Verwaltungsleitungen ganz konkret?
Soweit ich es sehen kann, verändert sich von der Sache her zunächst nichts Grundsätzliches. Das was bisher der Pfarrer zusätzlich zu seinem Dienst als Seelsorger zeitlich und inhaltlich einbringen musste, wird ihm künftig vom Verwaltungsleiter abgenommen: z. B. Bauanträge bearbeiten und einreichen, für eine geordnete Finanzverwaltung sorgen, Personalangelegenheiten regeln, den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantworten, den Datenschutz wahren, die Leitlinien für die Prävention im Blick behalten, usw. Das bedeutet nicht, dass der Pfarrer in all diesen Feldern künftig außen vor sein soll, er muss dies alles nur nicht mehr selber organisieren.
Was ist für Sie der entscheidende Unterschied zwischen kirchlicher Leitung und säkularer Leitung?
Leitung ist ein sachorientiertes Herangehen an Aufgaben, verbunden mit der Klärung, was in welcher Zeit von wem zu tun ist. Daneben hat Leitung mit Führung zu tun. Denn jenseits organisatorischer Regelungen geht es auch um die Beziehung zu Personen. Es geht also auch um Sinnvermittlung und motivations-psychologische Aspekte, wenn wir von Leitung sprechen. Wer führt, schafft individuelle Motivationsbedingungen und ist in eine Interaktionsbeziehung eingebunden. Wenn wir von kirchlicher Leitung und Führung sprechen, ist allerdings auf eine Besonderheit hinzuweisen: Während Wirtschaftsunternehmen sich an den Nützlichkeitsvorstellungen ihrer Kunden auszurichten haben, ist das kirchliche Wirken an den Nöten, Sorgen und Hoffnungen der Menschen orientiert. Daher geht es für die kirchliche Führungspraxis nicht um irgendeine „Gewinnerzielungsabsicht“. Kirchliches Wirken ist eine „Dienstleistung“, die sich am Evangelium Jesu Christi orientiert. Ein Grundwort des Evangeliums ist Gnade: Gnade aber ist nicht von dem Prinzip der Leistung und Gegenleistung bestimmt.
Wie gewährleisten Sie die Zusammenarbeit zwischen hauptamtlicher Verwaltung und ehrenamtlich getragenen Gremien vor Ort?
Hier muss und wird sich nichts wesentlich ändern. Wie gesagt: die Pfarrei ist und bleibt erster Ansprechort für alle seelsorglichen Anliegen. Es gibt daher in jeder PG – unter bestimmten Umständen auch in einer Pfarrei – wie bisher einen Pfarrgemeinderat, und in jeder Pfarrei ist eine Kirchenverwaltung etabliert. In diesen Gremien sind die Hauptamtlichen vertreten und arbeiten mit den Ehrenamtlichen in angemessener Weise so zusammen, damit die Werte des Evangeliums und das Selbstverständnis von Kirche zum Tragen kommen können.
III. Ehrenamt und Katechisten
Welche Formen des Ehrenamts erscheinen Ihnen zukunftsfähig – besonders angesichts wachsender Komplexität kirchlicher Aufgaben?
Die PG werden größer und die Zahl der Hauptamtlichen wird weniger werden, deshalb darf das Ehrenamt aber nicht zum Lückenfüller werden. Jene, die sich zur Verfügung stellen, müssen wissen, was sie in dieser oder jener Aufgabe erwartet und mit welchen Zeitengagement sie das leisten können. Wie sich das Ehrenamt in der Kirche künftig entwickelt, bleibt abzuwarten. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass sich das Leben der Menschen in diesen Zeiten anders gestaltet als dies noch vor Jahrzehnten der Fall war. Mit Sicherheit werden wir auch zukünftig Pfarrgemeinderäte und Mitglieder der Kirchenverwaltungen brauchen und um sie werben. Aber auch unsere Verbände mit ihren Mitgliedern sind ein wichtiger Grundpfeiler in unserer Diözese. Allen, die sich in den jeweiligen Bereichen einbringen, ist ein herzlicher Dank zu sagen für ihr Bekenntnis und ihr öffentliches Ja zur Kirche.
Welche Chancen sehen Sie mit der Neuschaffung der Katechisten-Ausbildung?
Die Ausbildung von Katechisten geht ursprünglich auf eine Initiative von Papst Franziskus zurück und wurde von Bischof Rudolf konsequent aufgegriffen. Er ist dafür der kompetenteste Ansprechpartner. Grundsätzlich halte ich die Idee für einen klugen und wichtigen Impuls, das Ehrenamt der Kirche um dieses Angebot zu ergänzen.
Wie motivieren Sie junge Erwachsene, die Kirche aktiv mitzugestalten, gerade in einer Zeit zunehmender Distanz zur Institution?
Es ist in der jüngeren Generation nicht anders als bei den älteren Generationen. Maßgeblich und durch nichts zu ersetzen, ist das realpräsente, personelle Angebot. Zweifellos spielt bei den jungen Menschen heutzutage das Thema Social Media eine sehr starke Rolle bei der Kontaktaufnahme bzw. der Kontaktpflege. Aber unsere jungen pastoralen Mitarbeiter und Priester haben pfiffige Ideen, um über diese Medien ins Gespräch zu kommen. Viele, so habe ich den Eindruck, haben ein traditionelleres Bild von Kirche als diese es tatsächlich ist. Daran gilt es zu arbeiten, damit auch Distanzierte erkennen, dass das, was unsere kirchliche Erzählgemeinschaft zu sagen hat eigentlich ganz interessant, tiefgründig und sogar hilfreich ist.
IV. Demographischer Wandel & Mitgliederrückgang
Wie verändert der vorhersehbare Rückgang der Kirchenmitglieder die theologischen Prioritäten einer Diözese? Welche Fakten vermittelt die Freiburger Studie?
Wir sehen einen konsequenten Rückgang an Kirchenmitgliedern, das hat vielerlei Gründe: Demographie, Kirchenaustritt, zunehmender Verlust eines Gottesbezuges.
In der theologischen Literatur beschäftigen sich viele mit dieser Thematik. Ein Buch, das derzeit im Gespräch ist, trägt den Titel: „Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt“. Das ist eine sehr ernüchternde Feststellung, wenn es so ist. Es gibt aber auch etliche Bücher, die sich den heutigen Herausforderungen stellen und fragen, wie die Kirche trotzdem ihren Auftrag so erfüllen kann, dass die Botschaft Jesu ankommt, u. a. beschäftigt sich Reinhard Marx in seinem Buch: „Kult. Warum die Zukunft des Christentums uns alle betrifft“ damit.
Bei all diesen Analysen, Überlegungen und Betrachtungen aber dürfen wir den Kopf nicht verlieren und müssen gelassen bleiben. Das soll nicht heißen, die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun. Jesus Christus hat uns zugesagt: Ich bin bei euch alle Tage. Wer darauf vertraut, der kann gar nicht verzagen. Zweifellos ist die Lage der Kirche in diesen Zeiten und in unserem Land schwierig und äußerst herausfordernd. Aber wo steht denn, dass wir eine Kirche der großen Zahlen sein müssen? Nicht die Zahlen machen die Kirche, es ist und bleibt die Botschaft Jesu Christi, die überzeugend und authentisch, in jedem Fall aber anders als vor 100 Jahren, in diese jetzt bestehende Gesellschaft hinein verkündet werden muss. Die aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung stellt interessanterweise fest, dass die Kirchen eine wichtige zivilgesellschaftliche Rolle haben und die Demokratie stärken. Dieser gesellschaftliche Beitrag und die in den Pfarreien gelebte Nähe zu den Menschen ist nicht nur erheblich, sondern auch ermutigend, sich in unserer Kirche für die Menschen zu engagieren.
Welche kirchlichen Angebote müssen Sie in Zukunft vielleicht aufgeben – und woran wollen Sie unbedingt festhalten? Wie kann die Kirche in einer alternden Gesellschaft weiterhin jugendpastoral glaubwürdig agieren?
Wenn wir von der katholischen Kirche sprechen, dann stellen wir heute sofort einen konfessionellen Bezug her. Katholisch-Sein aber heißt umfassend zu sein. Allein von diesem Blickwinkel aus betrachtet, gibt es nichts aufzugeben, weil wir die Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenslagen im Blick behalten sollen. Damit verbinde ich aber nicht, dass alle jetzt eingerichteten und bis ins Detail ausdifferenzierten Angebote in der Weise weitergeführt werden können. Es gilt, klug zu überlegen, was der Evangelisierung dienlich ist und was zwar auch wichtig, aber nicht unmittelbar der Evangelisierung hilfreich ist. Wichtig bleiben in jedem Fall die personellen Ressourcen, die so eingesetzt werden müssen, dass der Auftrag der Kirche zur Entfaltung kommen kann.
V. Finanzen & Immobilien
Welche Leitlinien geben Sie dem neuen Immobilienmanagement an die Hand, wenn es um Erhalt, die Umnutzung oder die Aufgabe geht? Welche Kriterien sind für Sie entscheidend, wenn es um die finanzielle Priorisierung innerhalb des Gebäudebestands also geht?
Hier stellt sich die Frage, um welche Immobilien es sich handelt. Geht es um Pfarrhäuser, Pfarr- und Jugendheime oder Kirchen? Kirchen sind die sichtbaren Identifikationsgrößen unseres Glaubens in unserem Land. Sie sind die Fingerzeige Gottes auf Erden und prägen unsere Dörfer, Märkte und Städte. Jetzt ohne größeren Anlass vom Auf- und Abgeben zu reden, halten ich nicht für zielführend. Es stimmt, die eine oder andere Klosterkirche beispielsweise hat für das liturgische Leben vor Ort an Bedeutung verloren, weil die Ordensgemeinschaft ihre Niederlassung aufgeben hat. In diesen Fällen sind die Ordensgemeinschaften zunächst in der Pflicht, sorgsam und weitblickend mit diesen Kirchen umzugehen. Wir stehen in diesen Situationen auch unterstützend zur Seite.
Für unsere Pfarrkirchen sehe ich 2025 und in den nächsten Jahren keinen derartigen Handlungsbedarf. Anders ist das bei Pfarrhäusern und Jugendheimen. In Pfarreiengemeinschaften, die 5 bis 6 Pfarreien umfassen, sind eben 3 bis 4 Pfarrhäuser und Jugendheime zu viel. Da gilt es Lösungen mit den Verantwortlichen vor Ort zu finden. Seitens des Ordinariates müssen je PG zwei Pfarrhäuser vorgehalten werden. Bei den Pfarrheimen sind wir, was die Anzahl betrifft, derzeit noch im Findungs- und Klärungsprozess. Wie mit den überzähligen Gebäuden umzugehen ist, das entscheiden die Verantwortlichen vor Ort. Sie müssen befinden, was sie darüber hinaus erhalten wollen und was sie aus eigener Kraft finanzieren können.
Entscheidend wird immer die Frage sein, ob die Nutzung der Pastoral dient, ob Leben in den Gebäuden herrscht und ob es Möglichkeiten gibt, Synergien mit Kommunen, mit Vereinen oder Privaten zu finden.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat in der Diözese gerade im Hinblick auf finanzielle Bezuschussungen?
Wir sind mit den staatlichen Stellen im häufigen Austausch. Alles in allem bin ich für das gute Miteinander sehr dankbar. Manchmal ist es schwer, zügig voranzukommen, da braucht es dann Zeit und auch ein gemeinsames Ringen, um zu Lösungen zu kommen, die beiden Seiten gerecht werden können. Es ist ja kein Geheimnis, dass auch auf Seiten des Staates die finanziellen Mittel begrenzt sind. Ich möchte aber auf das außerordentlich wertschätzende und wollwollende Miteinander auf Minister-Ebene hinweisen. Wir dürfen hier in Bayern wirklich sehr dankbar für das entspannte und konstruktive Miteinander sein. Ich kann mich hierzu nur anerkennend äußern.
Was passiert, wenn die Kirche Bildungseinrichtungen schließen muss – übernimmt diese dann der Staat?
Natürlich ist das auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Bildung liegt der Kirche sehr am Herzen und gehört zum Kernauftrag der Verkündigung. Bei uns im Bistum ist aber die Abgabe von Bildungseinrichtungen derzeit kein Thema.
VI. Geistliches Profil und Zukunftsperspektive
Was bedeutet es konkret, „den Himmel offen zu halten“ – liturgisch, spirituell und gesellschaftlich?
Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der das Irdische, das Materielle, das Funktionale und Pragmatische sehr wichtig zu sein scheint. Das Leben macht aber mehr als volle Kühlschränke und steigende Aktienkurse aus. Zudem kann ein Teil der Bürgerinnen und Bürger an den Gütern und Dienstleistungen nur schwer partizipieren. Diese Personen dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren.
Darum gilt es unseren Blick zu weiten oder anders ausgedrückt: Wir brauchen einen klaren Blick für das Leben, das den Himmel, die Transzendenz mit einbezieht. Unser Leben hat doch einen weit größeren Horizont als das bloße Verdienen, Erwerben und Produzieren. Vielmehr geht es doch ums Mit- und Füreinander, um die Eröffnung von Lebensräumen und Begegnungen. Und genau da liegt der Auftrag unserer Kirche offen vor Augen: Indem wir auf Gott verweisen, öffnen wir symbolisch gesprochen den Blick für den Himmel, um die Menschen auf den Mehrwert des Lebens hinzuweisen. Um es mit dem Lied von Rolf Zuckowski zu sagen: Leben ist mehr als Rackern und Schuften, Leben ist mehr als Kohle und Kies, Leben ist, miteinander zu reden, Leben ist, aufeinander zu bauen, Leben ist, füreinander zu kämpfen, Leben ist Hoffnung, Mut und Vertrauen.
Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung, angesichts der Herausforderungen, die auf die Kirche in den nächsten Jahrzehnten zukommen?
Papst Franziskus hat das Jahr 2025 unter das Motto „Pilger der Hoffnung“ gestellt. Das ist keine Vertröstung oder ein fauler Kompromiss. Hoffnung im christlichen Sinn bedeutet, immer wieder den Blick nach vorne zu richten und von der Zuversicht getragen zu sein, dass wir nicht tiefer als in die Hand Gottes fallen können. Die christliche Hoffnung bezieht sich daher auf keine innerweltliche Utopie. Sie hat Auswirkungen auf die Einstellung und das Verhalten der Christen, wenn diese Ja sagen zum Leben und einer Kultur des Todes entgegentreten. Es ist die christliche Hoffnung, dass die Liebe stets stärker als Hass, Ungerechtigkeit und Friedlosigkeit ist.
Kirche wird oft mit Macht in Verbindung gebracht. Aber Sie setzen auf Synodalität, synodale Gremien – oder anders gefragt, wie demokratisch ist die Kirche?
Was soll an Synodalität falsch sein? Im Rahmen des Synodalen Weges in Deutschland wird, so habe ich den Eindruck, Synodalität im Horizont eines Parlamentarismus gedacht. Dem kann ich nicht folgen. Papst Franziskus, der das Thema der Synodalität stark gemacht hat, spricht nicht von einer verfassungsgemäßen Synodalität, sondern von einer konstitutiven. D. h. es geht um eine Haltung und Einstellung zum Umgang miteinander. Ich sehe darin eine große Herausforderung für alle, die sich in die Kirche einbringen, ob Geistliche oder Laien. Es geht beim Thema Synodalität um weit mehr als um ein kirchenpolitisches Gremium mit Mehrheiten und Minderheiten.
Ich bin sehr dafür, die Kompetenzen und die Anregungen von Laien erst zu nehmen. Das ist eben nicht nur eine Frage der Etikette, sondern gehört zu einem aufrichtigen, wertschätzenden und achtsamen Umgang unter Christen. Ich bin auch dafür, den Kreis in unseren bestehenden Gremien, wenn möglich, zu erweitern, um denen eine Stimme zu geben, die danach begründet verlangen. Wer sich in Gremien einbringen möchte, muss aber auch Zeit, Bereitschaft zum Dialog und jeweils der Sache nach, nötiges Wissen mitbringen, sonst wird es sehr mühsam für alle Beteiligten.
Und eins dürfen wir in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen: Die rechtliche Verfasstheit unserer Kirche ist nicht einfach ein zu korrigierendes Beiwerk, sondern Identitätskennzeichen. Sie ist lehrende und hörende Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil, das zuletzt gerne als Zeuge für Synodalität angeführt wird, hat das hierarchische Grundverständnis des bischöflichen Amtes an keiner Stelle in Frage gestellt. Es geht also bei aller Wichtigkeit der Synodalität um die Hirtensorge, und die ist in unserer Kirche personal verankert. Es ist der Bischof, der diese persönliche Verantwortung trägt, und die kann er an kein Gremien abtreten.
Das Bistum Regensburg hat als eines der ersten in Deutschland das Thema Missbrauch aufgearbeitet. Verschiedene Studien sind dazu bereits 2017 erschienen. Wie geht es mit der Aufarbeitung des Themas Missbrauch weiter?
Nach dem Gutachten der Domspatzen haben wir ein weiteres Gutachten auf den Weg gebracht, das von der Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK) beauftragt worden ist und das von Herr Rechtsanwalt Weber bearbeitet wird. Es soll voraussichtlich 2027 veröffentlicht werden. Zudem hat die UAK darauf Wert gelegt, dass auch eine universitäre Studie der Fakultät für Katholische Theologie (Pastoraltheologie und Homiletik) unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Ute Leimgruber, Regensburg, das komplexe Feld Missbrauch ergänzt. Zwischenzeitlich haben wir auch eine Stabsstelle im Generalvikariat etabliert, die sich mit dem Themenfeld „Missbrauch Geistlicher Autorität“ auseinandersetzt und hier entsprechende Informationen und ggf. Hilfen anbietet.
Das Thema wird aber durch die Gutachten und Studien nicht abgeschlossen sein, sondern zu einem bleibenden Begleiter der Verantwortlichen auf allen Ebenen.
Was erwarten Sie sich vom Pontifikat von Papst Leo XIV.?
Es steht mir nicht zu, vom Heiligen Vater etwas zu erwarten. Sein Auftrag kommt von Christus selber: „Stärke deine Schwestern und Brüder im Glauben und leite die Kirche in und mit der Kraft des Heiligen Geistes“.
Was mich beeindruckt hat, war die Wahl des Namens Leo, mit dem er an die Tradition von Papst Leo XIII. anknüpft, der in der Arbeiterfrage des 19. Jh. wichtige Eckpunkte gesetzt hat und damit die Katholische Soziallehre aufs Gleis stellte. Als früherer Betriebsseelsorger und KAB/CAJ-Präses hat mich das bewegt und erfreut, da ich mich auch mit diesen Fragen auseinandersetzte und gesellschaftspolitische Fragen im Kontext von Theologie und Kirche bis heute für mich eine gewichtige Rolle spielen. Gerade im Blick auf die Industrie 4.0, KI und Digitalisierung sieht Papst Leo XIV. neue Herausforderungen für die Verteidigung der Menschenwürde, der Gerechtigkeit und der Arbeit. Dass wir als Kirche dazu kompetent etwas zu sagen haben, macht uns an das Leben der Einzelnen und der Gesellschaft anschlussfähig.
Was macht die Einzigartigkeit von Kirche und Glaube im 21. Jahrhundert aus – oder anders gefragt, den Mehrwert?
Die Kirche war und ist in jedem Jahrhundert einzigartig gewesen und wird es auch bleiben, sonst würde es sie nicht brauchen. Unsere Kirche ist kein Konzern und keine NGO. Das große Thema der Kirche ist die Sakralität, die keine andere Institution bieten kann. Leider hat sich in meinen Augen das Reden der kirchlich Verantwortlichen vor allem in unserer Liturgie zu sehr auf das theologische Sprechen und Reflektieren reduziert. Es braucht jedoch mehr das Herausgehoben- bzw. Erhobensein. Wer mit Kirche in Beziehung tritt, sucht hier doch keine politischen Erklärungen oder ideologische Manifeste. Kirche soll und will dazu beitragen, aus dem Alltäglichen herausgenommen zu werden, um etwas von der göttlichen Nähe zu erahnen und geistig-geistliche Orientierung zu erhalten. Mut zu fassen fürs Leben, um gesammelt und gesendet in aufrichtiger und bewusster Weise sein Leben zu leben, das ist m. E. die Sehnsucht vieler Menschen. Markenzeichen der Kirche ist es daher, für das wahre Menschsein einzustehen, über die Lebensspanne des Menschen hinauszuweisen und die transzendente Dimension ins Spiel zu bringen. Das ist der spezifische Mehrwert der Kirche – auf das Sakrale, auf Gott, den Unverfügbaren, zu verweisen. Und das spricht auch heute Menschen an.
Interview: Stefan Groß
(chb)
Weitere Infos
Sehen Sie sich weitere Menschen unserer Diözese an, die wir Ihnen als Person der Woche vorgestellt haben.