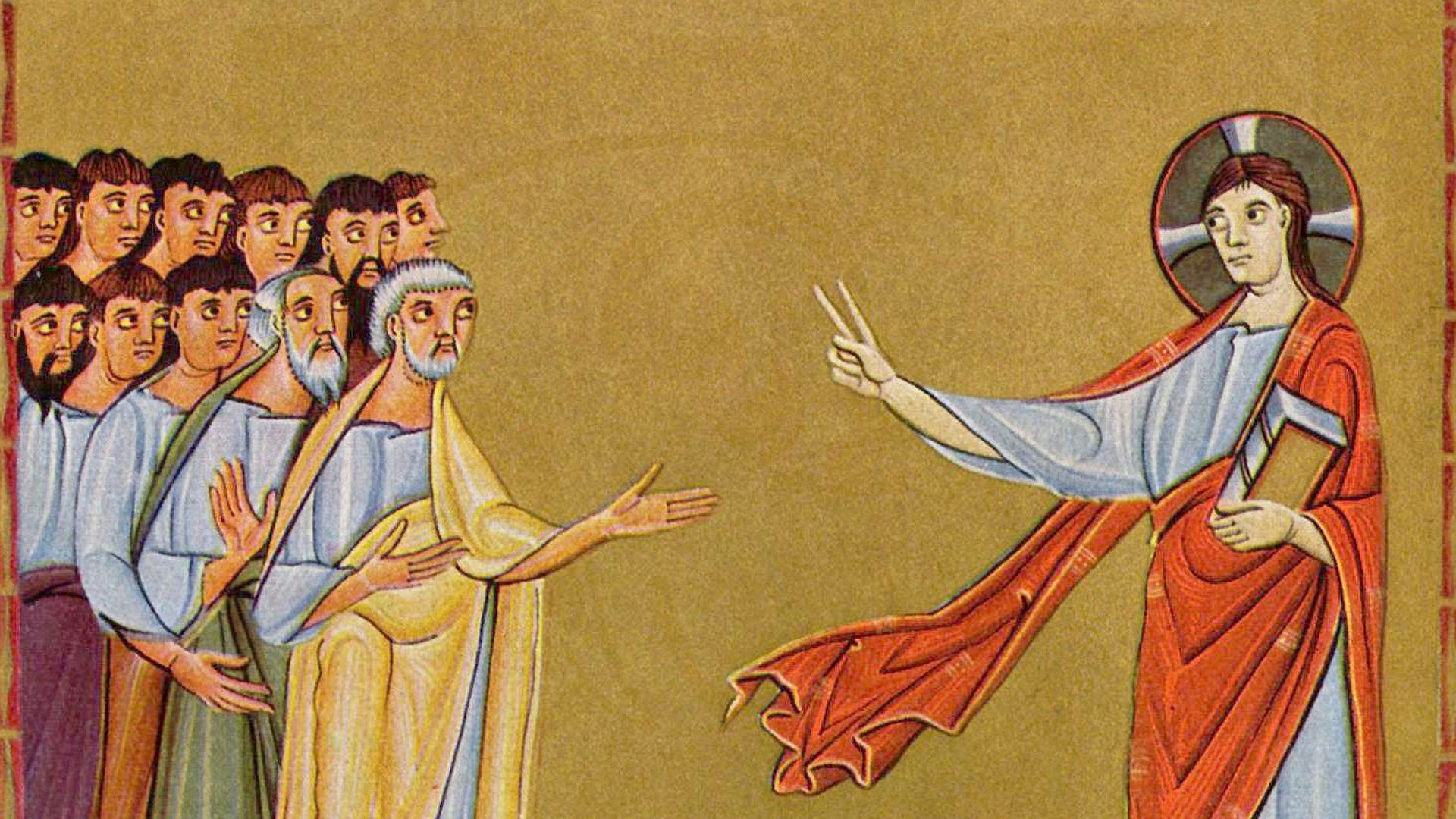Suche
Kategorien
Seiten
Nachrichten
Bilder
Videos
{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Seite{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Neuigkeit
Kirchen aus dem Bistum: Maria Himmelfahrt in Eslarn
Eine enge Verbindung zu den Handwerkszünften
Regensburg, 19. Juni 2025
Eine Barockkirche mit imposantem Akanthusalter und beeindruckenden Zunftstangen zeugt von einem lebendigen Glauben vor Ort und lebendiger Tradition.
Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Eslarn wird im Jahr 1326 erstmals urkundlich erwähnt. In der Reformationszeit gab es von 1550 bis 1625 eine evangelische Epoche. Bereits 1603 war die Kirche baufällig. Der Dreißigjährige Krieg erledigte den Rest und zerstörte die Kirche vollständig. Es dauerte bis 1681, dass ein Neubau in Angriff genommen werden konnte. Die Fertigstellung dauerte bis 1689. Der damalige Bau entspricht im Wesentlichen der heutigen Kirche. Zunächst hatte man den alten Turm im Westen übernommen. Dieser stürzte 1722 ein und wurde durch einen Neubau nördlich des Chorraumes ersetzt. Ein Großbrand zerstörte 1895 den Chorraum samt Hochaltar. Im Jahr 1910 wurde die Kirche nach Westen verlängert und zwei Treppentürmchen nördlich und südlich am Übergang zur Verlängerung angebaut. Im Jahr 1927 erhielt der Turm die typische Zwiebelhaube. Den markanten rot-weißen Außenanstrich bekam die Kirche bei der Renovierung in den Jahren 1967 bis 1969. Damit war die Kirche baulich so, wie man sie heute vorfindet. Es ist eine barocke Saalkirche, die als Wandpfeilerkirche ausgeführt ist. Die Pfeiler treten aus den Wänden hervor und unterteilen so die Wände in Seitenkapellen. Oberhalb dieser Seitenkapellen finden sich Emporen. Am Gewölbe der Kirche finden sich keine Stuckaturen.
Ein Akanthusaltar wie eine Monstranz
Die Ausstattung der Kirche hat sich ebenfalls über die Jahrhunderte immer wieder verändert. Die heutige Ausstattung und Aufstellung erfolgten bei der Renovierung im Jahr 1967. Im Chorraum steht ein Zelebrationsaltar. Dahinter ist ein Ensemble aus einem für die Oberpfalz typischen Akanthusaltar, der auf die Zeit um 1700 datiert. Er gilt als eines der originellsten Exemplare eines Großranken-Akanthusaltars. Das gesamte Ensemble wirkt wie eine übergroße Monstranz. Innerhalb der umgebenden silbernen Rosen findet sich eine gotische Marienstatue mit Jesuskind. Über dem Rahmen schwebt eine übergroße Krone. Oberhalb der Krone ist Gottvater als bärtiger Mann mit Weltkugel und Heilig-Geist-Taube dargestellt. Auf der linken Seite steht der hl. Josef, dargestellt mit Zimmermannssäge. Gegenüber auf der rechten Seite steht der hl. Joachim mit zwei Opfertauben. Unterhalb des Gnadenaltares befindet sich der Tabernakel.
Im Chorraum finden sich zwei weitere Altäre neben dem Gnadenaltar. Beide datieren auf das Jahr 1725. Der nördliche Seitenaltar zeigt die Kreuzigung Christi. Der südliche stellt das Pfingstgeschehen dar. Keiner der drei Altäre hat noch eine Mensa. Die beiden Seitenaltäre stehen auf verzierten Sockeln. Vor dem Chorbogen findet sich eine Rosenkranzmadonna, die wie der Altar auf das Jahr 1700 datiert. An der Chorbogenwand links steht eine barocke Madonna. Gegenüber findet sich die aus Holz geschnitzte Kanzel aus dem Jahr 1759 im Stil des Rokoko.
Am Korb der Kanzel finden sich Figuren der vier Evangelisten. Dazwischen sind kleine Reliefs biblischer Szenen angebracht. Neben der Stillung des Seesturmes finden sich hier Darstellungen der Gleichnisse vom Sämann und vom Guten Hirten. An der Rückwand hinter dem Prediger stehen Engel mit dem Kreuz Christi und den Gesetzestafeln. Der Schalldeckel ist mit Putten verziert, die die vier Erdteile darstellen. Oben auf dem Deckel steht eine Figur des Apostels Paulus. In den vier Seitenkapellen des Langhauses, die durch die hervortretenden Pfeiler entstehen, finden sich weitere Nebenaltäre. Die Altäre zeigen Johannes den Täufer in der Wüste mit dem heiligen Laurentius und dem heiligen Stephanus, die heilige Anna, die ihrer Tochter Maria Unterricht im Lesen erteilt, den heiligen Sebastian und den heiligen Franz Xaver, den heiligen Sebastian mit dem heiligen Leonhard und dem heiligen Nepomuk sowie den heiligen Josef mit dem heiligen Rochus und dem heiligen Florian.

Zunftstangen mit Engeln
Eine Besonderheit der Kirche sind die 14 erhaltenen Zunftstangen aus dem 18. Jahrhundert. Jede Stange hat einen Leuchterengel, der das Wappen der Zunft trägt. Auf jeder Stange findet sich jeweils eine stehende oder kniende Engelsfigur, die in der einen Hand einen großen Kerzenleuchter und mit der anderen Hand ein Schild mit den Symbolen des jeweiligen Handwerkes hält. Es gibt für jedes Handwerk zwei Engelstangen mit gleichartigen Engeln, die sich gegenseitig anschauen. Die Maurer, Bäcker, Wagner, Schlosser, Schmiede und Metzger haben weibliche kniende Engel, die Schreiner weibliche stehende Engel und die Zimmerer männliche stehende Engel. Während die weiblichen Engel lange Gewänder tragen, sind die männlichen Engel nackt mit einem rot-goldenen Tuch um die Hüften. Die Eslarner Handwerker organisierten sich seit dem 16. Jahrhundert in Zünfte. Die älteste Zunftsatzung stammt aus dem Jahr 1543 und betrifft die Schneider. Es folgten 1631 Handwerksordnungen für die Weißbäcker, 1677 für die Maurer und Zimmerer, 1710 für die Tuchmacher und 1772 für die Eslarner Müller, Metzger, Bäcker, Schuster, Schneider, Weber, Maurer, Zimmerer, Wagner, Schmiede, Schlosser, Schreiner, Glaser und Binder. Die Stangen wurden bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts bei Prozessionen mitgetragen. Es ging damals jeweils ein Vertreter der Zunft rechts und links der Prozession. Hier zeigt sich die einst enge Verbindung der örtlichen Handwerker zur Kirche. Heute stehen die Stangen an den Bänken im Mittelschiff der Kirche.
Das barocke Orgelprospekt im Westen der Kirche ist reich geschmückt und mit Putten verziert. Es stammt aus dem Jahr 1757. Hier wurde im Jahr 1973 ein neues Werk mit 26 Registern eingebaut, das 2021 auf 26 Register erweitert wurde. Weitere Renovierungen in den Jahren 1988, der Dachstuhl und 1993 im Innern der Kirche hielten das Bauwerk gut in Stand, so dass die Internetseite der Pfarrei sie zu Recht als markantes heimisches Wahrzeichen in der Talsenke von Eslarn bezeichnen kann.
Text: Peter Winnemöller
(lg)
Weitere Infos
In der Reihe Kirchen aus dem Bistum Regensburg stellen wir Kirchen, Klöster und Kapellen vor, die sich im weiten Einzugsgebiet der Diözese befinden.