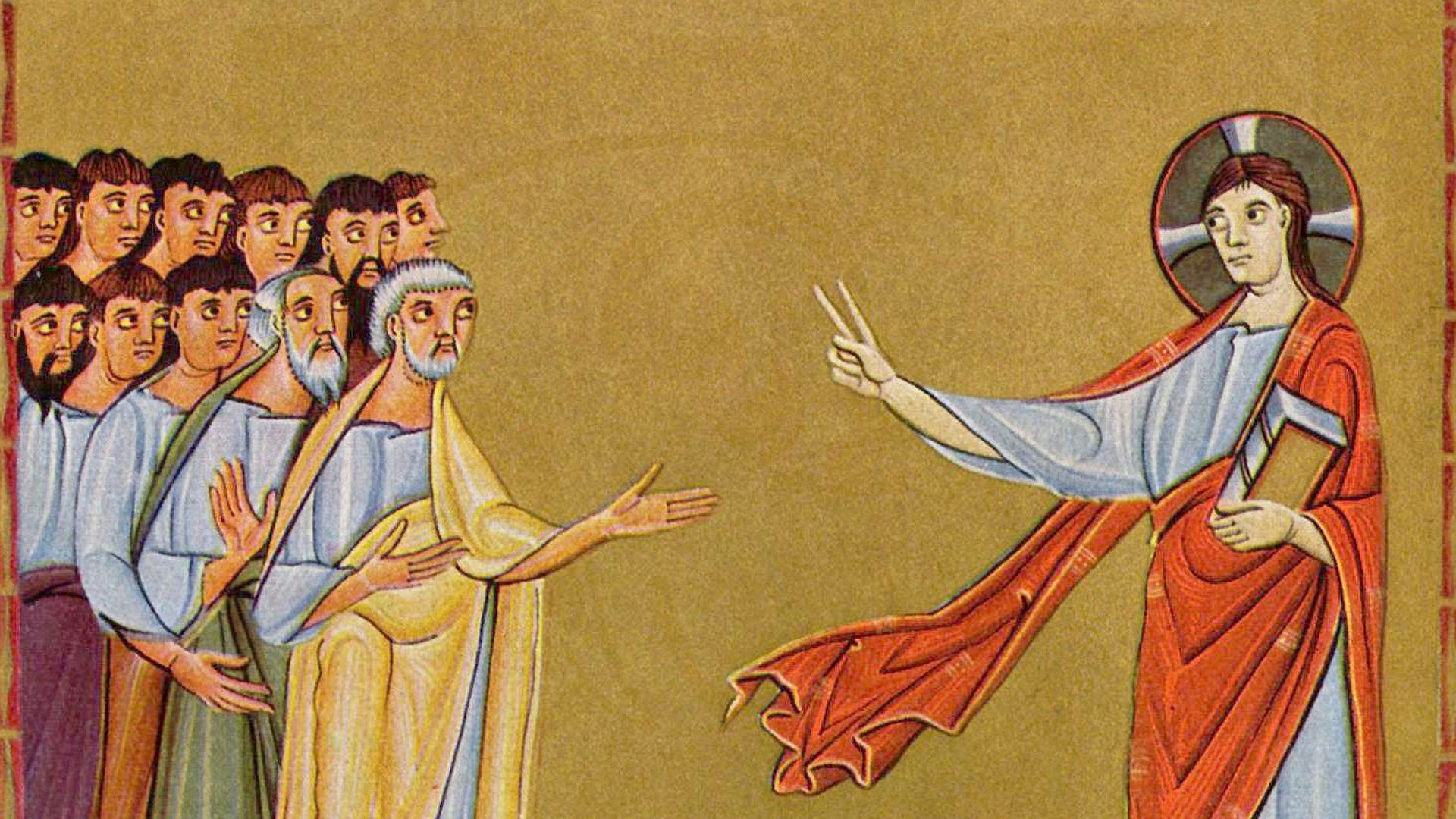Suche
Kategorien
Seiten
Nachrichten
Bilder
Videos
{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Seite{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Neuigkeit
An Fabian und Sebastian fängt erst der rechte Winter an
Die Sebastianikälte
Regensburg, 16. Januar 2025
Am 20. Januar steht der Gedenktag des heiligen Sebastian im Namenstagskalender. Der Heilige galt seit dem Mittelalter als Patron gegen den Schwarzen Tod, die Pest. So glaubte man, er werde mit den von Gott gesandten Giftpfeilen die tödliche Krankheit bannen. In vielen Städten wurden im Mittelalter Sebastiani-Bruderschaften gegründet, um sich durch gemeinsames Gebet und feierliche Umzüge vor der schlimmen Seuche zu schützen. Und noch heute finden um seinen Namenstag in vielen Orten Prozessionen statt, die auf Gelübde in der Pestzeit zurückgehen.
Vielseitiger Patron
Da man der Legende nach den heiligen Sebastian an einen Baum gefesselt und mit Holzpfeilen gemartert hatte, wurde er auch zum Schutzpatron der Holzfäller und Waldarbeiter. An seinem Namenstag durfte kein Baum verletzt werden. So kam es, dass die Waldarbeiter früher an diesem Tag ihren Feiertag begingen. Der Heilige gilt aber auch als Patron der Brunnen, der Sterbenden, von Schützengilden, Soldaten und Kriegsinvaliden, der Büchsenmacher, Eisengießer, Zinngießer, Steinmetze, Gärtner, Gerber, Töpfer, Bürstenbinder und Leichenträger.
Um Fabian und Sebastian
Um Sebastian, hieß es früher, ist die kälteste Zeit des Winters. Und so entstand im Volksmund der Begriff „Sebastianikälte“. Die Meteorologen erklären das Wetterphänomen damit, dass zwischen dem 16. und 26. Januar oft trockenes, kaltes Hochdruckwetter vorherrscht, das dann die frostigste Zeit des Winters beschert. „An Fabian und Sebastian fängt der rechte Winter an“, heißt es in einer alten Bauernregel, oder „Haben Fabian und Sebastian nach Kälte Verlangen, musst du um deinen Vorrat an Brennholz bangen“. Doch die Bauern freuten sich über die strenge Kälte, denn sie wussten: „Verschließt tiefer Schnee zu Sebastian die Saaten, wird unser täglich Brot gut geraten“.
Gefürchtet waren dagegen eher milde Temperaturen, denn aus Erfahrung wusste man „Ist es um Fabian und Sebastian schon warm, wird das Jahr meist Futter arm“.
Verschiedene Kälteperioden
Auch an Pauli Bekehr am 25. Januar hofften die Bauern auf frostiges Wetter, denn „St. Paulus kalt mit Sonnenschein, wird das Jahr wohl fruchtbar sein“.
Der Tag der Bekehrung des Apostels Paulus war früher ein wichtiger Wetterlostag. Eine Bauernregel zum Paul-Bekehr-Tag ist sogar durch langjährige Wetteraufzeichnungen bestätigt: „Ist zu Pauli-Bekehr das Wetter schön, wird man ein gutes Frühjahr sehn; ist das Wetter aber schlecht, kommt es spät als fauler Knecht“. Halbwintertag hieß dieser Tag früher im Bauernkalender, denn: „Pauli Bekehr – der halbe Winter hin, der halbe her“. Über kaltes und sonniges Wetter an diesem Tag freuten sich die Bauern, doch „Wenn’s regnet und schneit, wird teuer das Getreid“, und „Sankt Pauli Regen, schlechter Segen“. Am 22. Januar, an Vinzenzi, galt: „Wie das Wetter um Vinzenz war, wird es sein das ganze Jahr“, und man wusste: „Auf trockenen, kalten Januar, folgt viel Schnee im Februar“.
Lichtmess hell und klar
Ein weiterer wichtiger Wetterlostag war der Lichtmesstag am 2. Februar. „Wenn’s an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit“, sagt die Bauernregel. Und das lässt sich sogar durch die moderne Meteorologie bestätigen. Denn wenn die Sonne um diese Jahreszeit „heiß“ scheint, bedeutet das eine stabile Hochdrucklage und kräftige Nachtfröste bei klarem Himmel. Hoher Luftdruck im Winter kommt bei uns aber immer als Festlandkaltluft aus Osteuropa und Sibirien – mit hoher Wahrscheinlichkeit sind dann auch im Februar und März noch überdurchschnittlich viele Frosttage zu erwarten.
Text: Judith Kumpfmüller