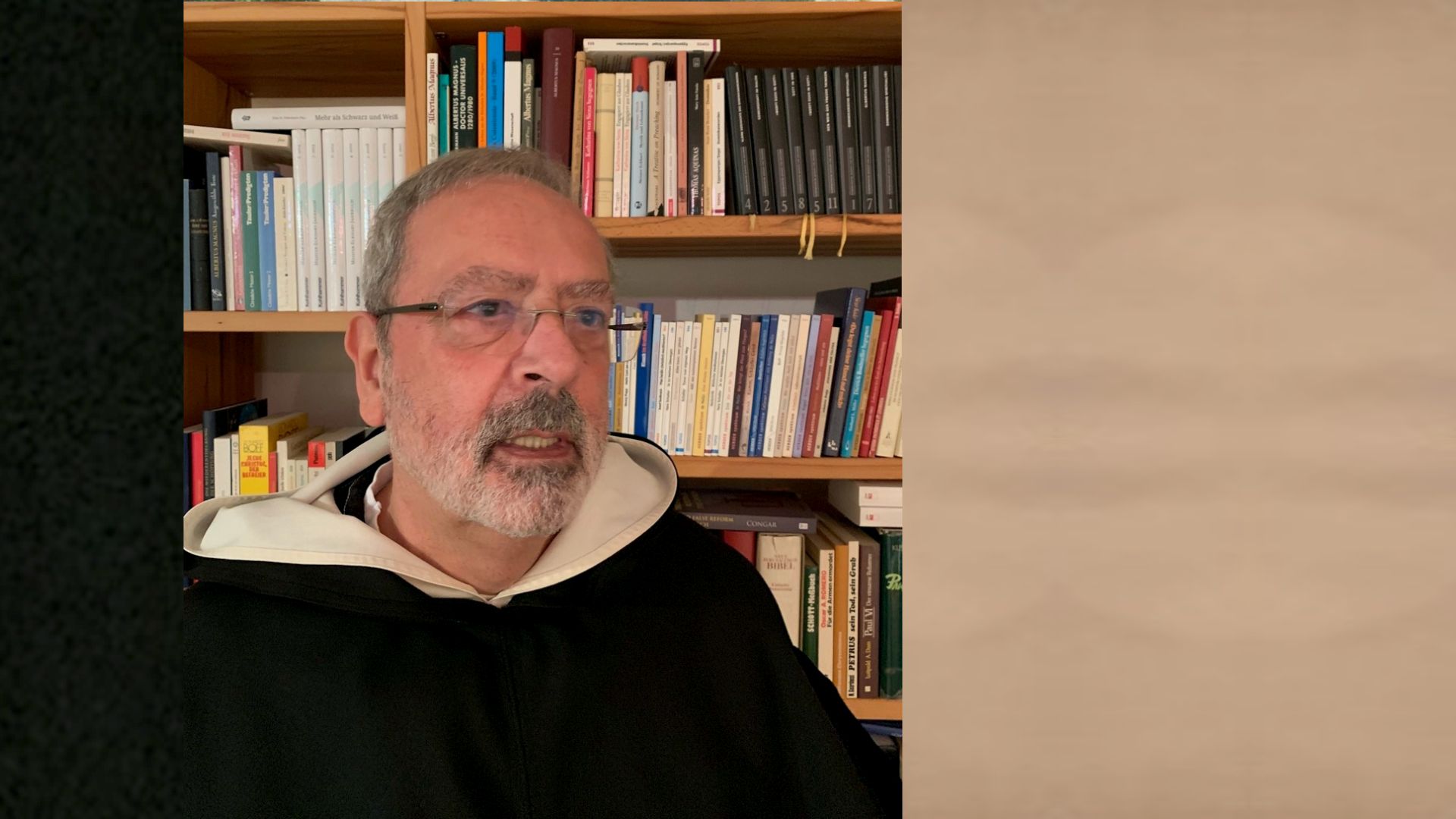Suche
Kategorien
Seiten
Nachrichten
Bilder
Videos
{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Seite{{{_highlightResult.post_title.value}}}
{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}
Zur Neuigkeit
Prof. Kreiml über das Gesetz des Weizenkorns
Die überfließende Liebe Christi
Regensburg, 15. April 2025
Christ wird man nicht für sich, sondern für das Ganze. Wie dies Jesus im berühmten Gleichnis vom Weizenkorn übersetzt, schildert Professor Josef Kreiml.
In seinem „Motu proprio“ zur Veröffentlichung des „Kompendiums des Katechismus der Katholischen Kirche“ vom 28. Juni 2005 bezeichnete Papst Benedikt XVI. Jesus Christus, der „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6) ist, als das „vorzügliche Geschenk, das Gott der Menschheit gemacht hat“. Benedikt XVI. äußerte die Hoffnung, dass die Leser des Kompendiums „immer mehr die unerschöpfliche Schönheit, Einzigkeit und Aktualität“ (Katechismus der Katholischen Kirche. Kompendium, München 2005, S. 10) dieses vorzüglichen Geschenkes erkennen.
Das Ungenügen des Menschen
Bereits in seinen Predigten über den „Sinn des Christseins“ aus dem Jahr 1964 hatte Joseph Ratzinger wichtige Aussagen über Jesus Christus vorgelegt, die auch in späteren Jahren für ihn prägend blieben: Obwohl mit dem erstmaligen Auftreten von Geist und Bewusstsein in der Menschheitsgeschichte eine „entscheidende Wende“ in der kosmischen Symphonie eingetreten ist, vermag – so Theologieprofessor Joseph Ratzinger in seinen Münsteraner Predigten von 1964 – der Mensch allein sich selbst und der Welt „keinen genügenden Sinn“ (J. Ratzinger, Vom Sinn des Christseins. Drei Predigten, München Neuausgabe 2005, S. 69) zu geben. Existierte in der Welt nur menschlicher Geist, so würde die Bewegung des Kosmos am Ende in einem „tragischen Lauf ins Leere“ enden.
Rückkehr zum Schöpfer
Den entscheidenden Umbruchspunkt in der Menschheitsgeschichte markiert die Menschwerdung Christi. In diesem Ereignis ist nicht nur der Durchbruch von Natur zu Geist erfolgt, sondern der Durchbruch vom Schöpfer zum Geschöpf. Damit sind an einem Punkt der Geschichte „Welt und Gott eins geworden“. Der Sinn aller nachfolgenden Geschichte kann im Grunde nur noch darin bestehen, „die ganze Welt einzuholen in diese Vereinigung und ihr von daher den erfüllten Sinn zu geben“ (ebd.), der in ihrer Einheit mit dem Schöpfer besteht. Das Wort des Kirchenvaters Athanasius von Alexandrien (um 300-373) „Gott ist Mensch geworden, damit die Menschen zu Göttern würden“ beschreibt den „eigentlichen Sinn der Geschichte“. Im Durchbruch von Welt zu Gott erhält alles Vergangene und alles Zukünftige seinen „Sinn als Einbeziehung der großen kosmischen Bewegung in die Vergöttlichung“ (ebd., S. 70), d. h. in ihre Rückkehr zum Schöpfer.
Die neue Existenzform des „Füreinanderseins“
Von dieser Sinnbestimmung der Rückkehr der gesamten Schöpfung zu Gott her leitet der spätere Papst Benedikt XVI. ein „persönliches Programm“ für jeden Menschen ab: Die ungeheure Alternative für den Menschen besteht darin, entweder sich in die kosmische Bewegung der Schöpfung einzuordnen und so Anteil zu gewinnen am Sinn des Ganzen oder sich dieser Linie zu verweigern und damit sein Leben der Sinnlosigkeit zu überantworten. Christsein heißt Ja sagen zu dieser Bewegung der geschöpflichen Wirklichkeit und sich in ihren Dienst stellen. Christ wird man – in einem gewissen Sinn – nicht für sich, sondern „für das Ganze, für die anderen, für alle“. Christ werden bedeutet das Bereitsein zu einem Dienst, den Gott seinem Geschöpf Mensch in der Geschichte aufträgt. Wer den Namen Christi trägt, stellt sich zum „Dienst für das Ganze“ zur Verfügung. Er versucht, die Existenzform des Egoismus aufzugeben und in die neue Existenzform des „Füreinanderseins“ einzutreten. Darin besteht – so Joseph Ratzinger – die entscheidende Dimension der ganzen Heilsgeschichte.
Das „Gesetz des Weizenkorns“: Tod und Auferstehung Christi
Am tiefsten hat Jesus diese fundamentale Dynamik der gesamten Schöpfung im „Gesetz des Weizenkorns“ formuliert. Das Gleichnis bringt anschaulich zum Ausdruck, dass dieses Grundgesetz nicht nur die Heilsgeschichte, sondern die ganze Schöpfung prägt (vgl. Joh 12,24). In seinem Tod und in seiner Auferstehung hat Christus das „Gesetz des Weizenkorns“ erfüllt. Er ist in der Eucharistie zur hundertfältigen Frucht geworden, von der wir leben. Im Geheimnis der Eucharistie, in dem er der wahrhaft und ganz Für-uns-Seiende ist, fordert Christus uns auf, täglich in dieses Gesetz des Füreinanderseins einzutreten, in dem das Wesen der wahren Liebe besteht. Liebe kann nur bedeuten, den verengten Blick auf das eigene Ich aufzugeben, hinauszugehen aus dem eigenen Selbst, um da zu sein für die anderen. In dieser Grundbewegung der Liebe, die die „Grundbewegung des Christentums“ ist, nimmt der Mensch teil an der schöpferischen Liebe Gottes, der alle Menschen zum Miteinander und Füreinander führen will. In Jesus Christus ist „der entscheidende Durchbruch der Weltgeschichte auf die Vereinigung von Geschöpf und Gott hin“ geschehen. Der bleibende Anstoß und die bleibende Größe der christlichen Botschaft bestehen darin, dass das Schicksal der ganzen Menschheitsgeschichte an Jesus von Nazaret, d. h. an einer einzigen Person, hängt. An Jesus Christus wird sichtbar, dass wir füreinander da sind und voneinander leben.
Leere oder Sinnfülle?
Der Mensch kann – so die entscheidende Einsicht Joseph Ratzingers – von sich aus der Geschichte keinen Sinn geben. Bliebe er der einzige Akteur der Weltgeschichte, dann wäre die Menschheitsgeschichte gnadenlos der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Dabei verweist der spätere Papst Benedikt XVI. auf Dichter des 20. Jahrhunderts, die die Langeweile und Vergeblichkeit als Grundgefühl des Menschen beschrieben haben. Christus hat dem Ganzen der Menschheitsgeschichte die entscheidende Sinndimension verliehen. Der in seiner Menschwerdung Wirklichkeit gewordene Durchbruch vom Schöpfer zum Geschöpf hat die „Bewegung ins Leere“ zu einer „Bewegung in die Fülle ewigen Sinnes“ umgewandelt.
Die überfließende Liebe Christi
Durch den „stellvertretenden Überfluss“ seiner Liebe hat Jesus Christus das „Defizit unserer Liebe“ aufgefüllt. Glauben heißt zugeben, dass wir ein solches Defizit haben, und die Bereitschaft aufbringen, sich von Gott beschenken zu lassen. Erst in solchem „Glauben“ endet der Egoismus. Insofern ist Glaube in der wahren Liebe implizit präsent. Der Glaube ist „jenes Moment an der Liebe, das sie wahrhaft zu sich selber führt“ (ebd., S. 99), nämlich in die Offenheit dessen, der nicht auf seinem eigenen Können besteht, sondern sich als Beschenkten und als Bedürftigen weiß. In der Geste des Glaubens, in welche wahre Liebe übergehen muss, liegt der verlangende Ausgriff auf das Christusgeheimnis. Alles im kirchlichen Glauben Begegnende ist letztlich Auslegung der „entscheidenden und wahrhaft genügenden Grundwirklichkeit der Liebe Gottes und der Menschen“ (ebd., S. 101; vgl. auch Papst Benedikt XVI., Enzyklika „Deus Caritas est“, Nr. 12-15, Bonn 2006). Die Grundstruktur des Überflusses prägt die ganze Schöpfung und die ganze Heilsgeschichte. Dabei handelt es sich um die Torheit einer Liebe, die sich jeder Berechnung enthält und vor keiner Verschwendung zurückschreckt.
Text: Domkapitular Prof. Dr. Josef Kreiml, Leiter der Hauptabteilung Orden und Geistliche Gemeinschaften im Bistum Regensburg
(kw)